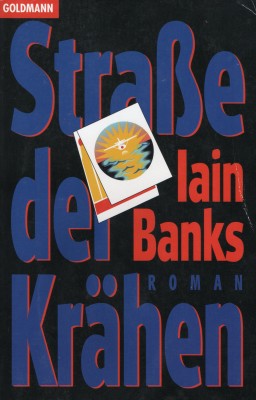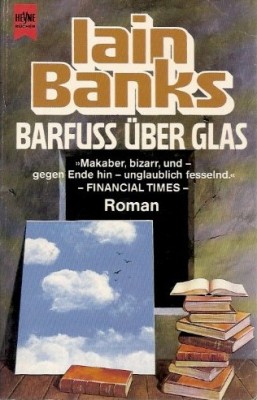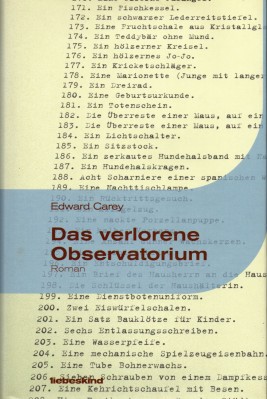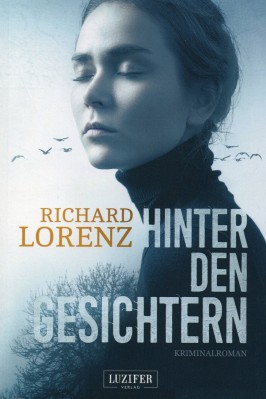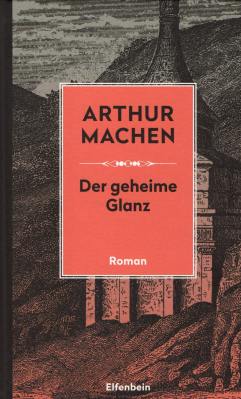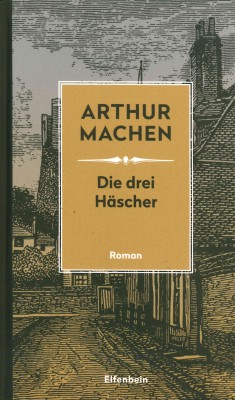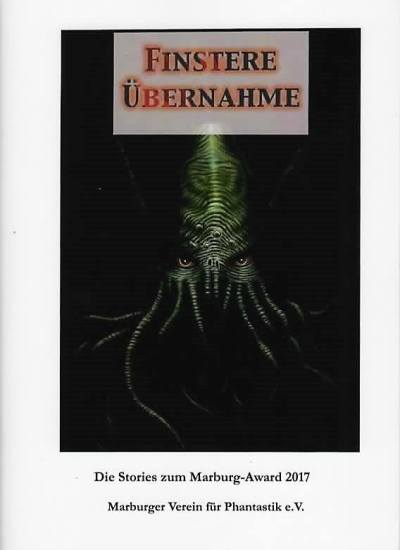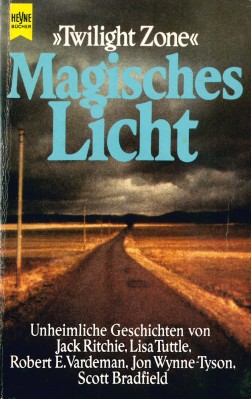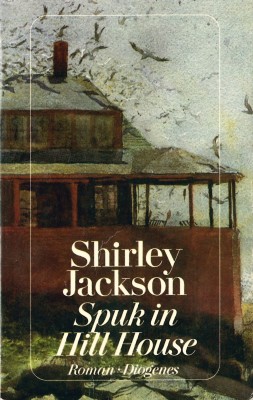Originalveröffentlichung:
The Crow Road (1992)
In dieser alles andere als gemütlichen schottischen Familiengeschichte stellt sich der junge Protagonist die Fragen seines Lebens und ist am Ende nicht mehr Derselbe
Mit seinem Opus Magnum The Crow Road [Straße der Krähen] kehrt der wilde Schotte Iain Banks in seine Heimat zurück. Es gibt Kilts, Lochs und Alkohol – viel Alkohol. Apropos. Es ging die Runde, dass Banks mit Vorliebe Science-Fiction-Cons besuchte, um sich dort dann voller Inbrunst einen nach dem anderen einzugießen. Das passt gut mit The Crow Road überein, denn auch hier scheint Whiskey neben Muttermilch das einzige schätzenswerte Getränk zu sein. Banks, selbst kein Kind von Traurigkeit, porträtiert hier einen Lebensstil und nicht etwa eine coole Attitüde, so viel ist mal klar.
The Crow Road beginnt mit einem furiosen Satz. Ich glaube, keiner hat je das Buch rezensiert, ohne diesen Satz zu zitieren. Der Mensch ist ein Herdentier, also zitiere auch ich ihn: „Es war der Tag, an dem meine Großmutter explodierte.“
Angesichts dieses Einstiegs und weil der Waschzettel uns verrät, dass es sich bei The Crow Road um ein Familienepos handelt, könnte man sich zu dem Gedanken verleitet sehen, es handele sich um einen pikoresken Wälzer der Marke John Irving, voller Übertreibungen und Ausuferungen. Aber ich kann euch beruhigen, The Crow Road hat in diesem Club nicht viel zu suchen. Im Gegenteil, obwohl The Crow Road – insbesondere im ersten Drittel – den Eindruck erweckt, wirklich jedes Persönchen der Handlung potenziere sich gleich dutzendweise in Verwandte und Freunde (strebsam wie ich bin, habe ich mir zu Anfang tatsächlich einen Stammbaum gemalt, der mir sämtliche verwandschaftlichen Verbindungen plastisch darstellt, aber das stellte sich als Fehlinvestition heraus, da die Charaktere alle für sich stehen und es letztlich völlig egal ist, wer wessen Tante ist), zeigt sich insbesondere im letzten Drittel, dass das Buch in Wirklichkeit über ein sehr straffes Konzept und einen sauber konstruierten Plot verfügt und es eben nicht um den McHoan-Clan in seiner Gesamtheit geht, sondern in erster Linie um den Ich-Erzähler Prentice McHoan, um seine Schwierigkeiten erwachsen zu sein und sich im Leben der Neunziger Jahre zurechtzufinden. Das ist beileibe kein neues Thema, aber es bedarf erst eines innovativen Autors wie Iain Banks, um der traurigen Gesellschaft vieler ewig betroffener Mainstream-Greise zu zeigen, wie man solch ein Thema anpackt, wie man modern und dabei gleichzeitig realistisch-wahrhaftig sein kann.
Für mich spielte während der Lektüre eine Vorstellung der Person Iain Banks eine nicht unwichtige Rolle. Als ich vor vielen Jahren ein Interview mit ihm las, war ich überrascht, wie wenig dieser Man zu sagen hatte. Alles, was ich dachte war, dieser oberflächliche, unbeschwerte Typ schreibt solche Bücher? Die Frage, ob es einfach an einem lauen Interview lag, oder ob Banks in Wirklichkeit ein wohlbehüteter Schreibtischtäter war, stellt sich für mich aber nicht mehr. Denn, wer so tiefen Einblick in die Seele eines jungen Menschen gewährt, wie Iain Banks das in The Crow Road mit Prentice praktiziert hat, weiß sehr viel über das Leben, und es ist eine Bereicherung für jeden Leser, wenn solch ein Mensch in der Lage dazu ist, diese Weisheit des täglichen Lebens in solch eine furiose Geschichte zu verpacken, wie The Crow Road es ist.
Prentice McHoan, Anfang zwanzig, ist der mittlere Sohn des weitverzweigten McHoan-Clans. Solange er zurückdenken kann, quälen ihn Fragen (die englische Originialausgabe listet sie im Klappentext alle auf): Wird die goldhaarige Verity ihn jemals beachten? Weiß Ashley Wart, dass er es war, der ihr mit einem Stein im Schneeball die Nase brach als sie noch ein Schulmädchen war? Gibt es einen Gott? Lebt Onkel Rory noch, oder ist er die Straße der Krähen entlanggegangen?
Prentice stellt sie sich jedoch nicht „irgendwann einmal“, sondern sie beherrschen sein Leben. Als die von ihm verehrte Verity seinen Bruder heiratet, geht es mit ihm rapide bergab, sein Leben gerät aus den Fugen, er selbst an den seelischen Abgrund. Mit düsteren Symbolen des gerade ausbrechenden Golfkrieges beladen, hält uns das Buch sehr plastisch vor Augen, wie es war, in den Neunzigern zu leben.
Ich muss gestehen, dass ich erst Skrupel hatte, das Buch zu beginnen. Zu frisch sind mir noch Banks ersten beiden Romane The Wasp Factory [Die Wespenfabrik] und Walking on Glass [Barfuß über Glas] in Erinnerung, die teilweise niederschmetternde Ausweglosigkeit, der Mangel an positiver Tendenzen. Da hat sich bei Banks einiges getan. Es ist beispielsweise geradezu rührend, wie Prentice‘ Vater mit einer Horde Kinder durch die stellenweise prähistorisch anmutende schottische Landschaft stiefelt und die Gören ihm mit leuchtenden Augen an den Lippen hänge, während er ihnen selbsterdichtete Märchen und Geschichten erzählt. Außergewöhnlich auch die Verständigung der Generationen miteinander. Obwohl Gespräche zwischen Vater und Sohn in The Crow Road zum absoluten Bruch führen können – immerhin reden sie miteinander.
Geht man davon aus, das jedes Buch ein Spiegel der jeweiligen Verfassung seines Autors ist, so zeigt uns The Crow Road einen gereiften Iain Banks, der aber immer noch den Wilden, den Störer, den Schocker, den Tabubrecher (sämtliche Sexszenen im Buch sind von unbeschreiblicher Einmaligkeit) in sich hat. Musste Walking on Glass, ein Buch ähnlicher Gefühls-Thematik (Angebetete missachtet ihren Verehrer) in Mutlosigkeit und zerstörtem Vertrauen in die Menschheit enden, so schließt The Crow Road voller Zuversicht und Wärme, trotz all der grotesk Verunglückten und Ermordeten im Laufe des Buches.
Weiter oben habe ich noch geschrieben, The Crow Road drehe sich einzig um Prentice McHoan. Das ist so allerdings nicht ganz richtig. Lange Dialoge zwischen den unterschiedlichsten Charakteren spielen eine sehr große Rolle. Banks erreicht dadurch eine Polyphonie, die Prentice und seine Welt erst so richtig wahr werden lässt. Banks trickst damit virtuos herum. Ein Beispiel: oft reden im „Hintergrund“ die Nebenfiguren (erstaunlich, dass so etwas in einem Roman überhaupt möglich ist), während Prentice abwesend seinen eigenen Gedanken nachhängt. Das Buch ist also, wie der überhebliche Nachwortschreiber der deutschen Ausgabe, Sky Nonhoff es salopp ausdrückt, nicht einfach nur „dialog- und diskurslastig“.
The Crow Road ist ein Buch, vor dem jeder Rezensent, der nicht gerade hunderte Seiten zur Verfügung hat, kapitulieren muss. So viele Nebengleise, die ich leider hier unter den Tisch fallen lassen muss. Es ist ein Buch, nach dessen Lektüre man nur beeindruckt flüstern kann: Ein Meisterwerk!
Und so beschließe ich diese Besprechung mit einem schottischen Trinkspruch: Hoch die Tassen. Slainthe Math!
Deutsche Übersetzung: Straße der Krähen, übersetzt von Jonathan Gates (München: Goldmann, 1996)
Erstveröffentlichung dieser Rezension in: dandelion, Nr. 6, Sommer 1996.
Die Rezension wurde für diese Veröffentlichung überarbeitet