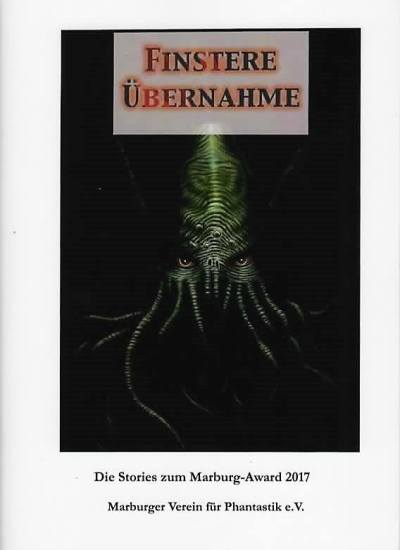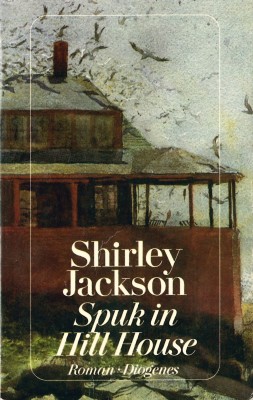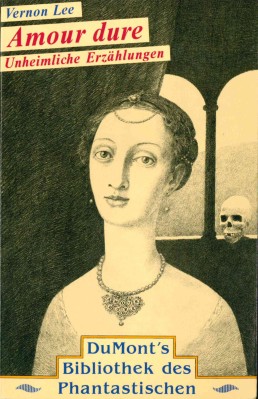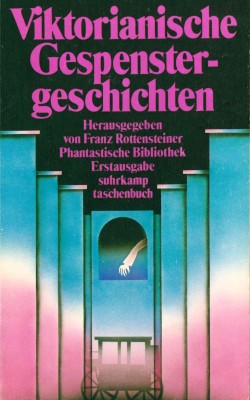Originaltitel: The Haunting of Hill House (1959)
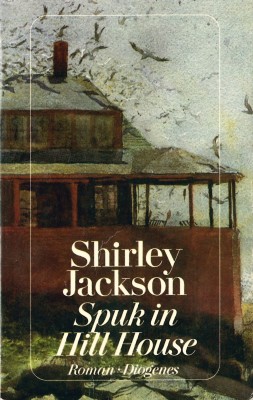
Die größte aller Spukhausgeschichten ist auch eine dunkle Reise in die Psyche einer unterdrückten Frau, die ausgerechnet in dieser Heimstatt der Angst dem ersten Glück ihres Lebens zu begegnen hofft.
Kaum eine Empfehlungsliste der besten klassischen Horror-Romane kommt ohne diesen Roman aus. In der Abteilung Spukhaus-Geschichten führt er die Listen in der Regel an: The Haunting of Hill House [Spuk in Hill House] von Shirley Jackson. Genau diese kollektive Einschätzung hat aber auch vermutlich verhindert, dass der Roman in den amerikanischen Literatur-Kanon aufgenommen wurde, wo er meiner Meinung nach aber hingehört. Es ist ein Fehler, The Haunting of Hill House auf einen Schauerroman zu reduzieren, aber ich verstehe durchaus, warum das so oft passiert.
Die Struktur von The Haunting of Hill House erinnert mich an die Aufnahmetechnik eines Musikstücks. Die unterschiedlichsten Tonspuren werden dabei aufgenommen, um am Ende zusammengemixt zu werden. Über eine ähnliche Textur verfügt The Haunting of Hill House, denn auch dieser Roman besteht aus einer Vielzahl von „Tonspuren“, die allesamt intensiv miteinander interagieren. Einige stehen laut im Vordergrund, andere sind so versteckt und leise, dass man sie nur bei genauem Lesen wahrnimmt. Nur, wer das Konzept dieses großen Ganzen erfasst, bekommt eine Ahnung davon, wie mächtig dieser schmale Roman in Wirklichkeit ist.
Das ist auch der Grund, warum es schlichtweg unmöglich ist, The Haunting of Hill House in einer Buchbesprechung allumfassend zu knacken. So existieren zahlreiche literaturwissenschaftliche Studien zum Werk, die in die unterschiedlichsten Richtungen ausschwärmen und den Eindruck erwecken, jeder Autor derselbigen habe ein anderes Buch gelesen. So schwächeln insbesondere jene Rezensionen, deren Autoren suggerieren wollen, das Buch besiegt zu haben. Es gehören auch renommierte Namen wie Stephen King und S. T. Joshi dazu, die zwar ohne Zweifel kluge Gedanken dazu niedergeschrieben haben, aber auch trotz aller Selbstsicherheit nicht darüber hinwegtäuschen können, dass ihnen wichtige Fixpunkte des Romans schlichtweg entgangen sind.
Im Gegensatz zu meinen berühmten Kollegen möchte ich hier also erst gar nicht so tun, als habe ich The Haunting of Hill House erfolgreich zugeritten und gebeugt. Aber ein paar Gedanken habe ich mir trotzdem gemacht.
Worin bestehen aber nun die einzelnen Schichten des Romans? Ich bin nicht annähernd geschult genug, um viele der Schlösser zu öffnen, die Hill House sichern wie einen dunklen Schatz. Doch manches, was in Hill House vor sich geht, bietet durchaus Grundstoff genug, um hier einige Interpretationen vom Stapel zu lassen.
Die Romankomponente, die sich am lautesten in den Vordergrund drängt, ist natürlich deutlich der Spukhaus-Plot. Er ist das erste, worauf man sich fixiert, der zunächst einzige Anker, den man hat. Bei anspruchsvollen Schauerromanen – nehmen wir beispielsweise The Turn of the Screw [Das Durchdrehen der Schraube] von Henry James – neigt die Gutachterkaste des Feuilletons gern dazu, das Übersinnliche als Metapher des Psychologischen anzusehen, weil ihre Hohepriester nicht so gern zugeben wollen, dass sie sich mit einen Horror-Roman die Hose schmutzig gemacht haben. Letztlich ist The Haunting of Hill House in der Tat auch oder möglicherweise sogar vorwiegend ein psychologischer Roman, doch wie die Biographen verkünden, hatte Jackson auch ein großes Interesse an Okkultismus, so dass man wohl davon ausgehen kann, dass sie durchaus mit großer Lust und absolutem Ernst bei der Konstruktion ihrer unheimlichen Geschichte tätig war und die Thematik sicherlich nicht mit gerümpfter Nase lediglich als reine Metaphorik zu verstehen wünschte.
Viele, die The Haunting of Hill House zum ersten Mal lesen, mögen sich vielleicht fragen, warum allgemein solch ein Wirbel um das Buch gemacht wird, denn auf seine Horror-Essenz reduziert, gibt es wahrscheinlich auf Anhieb aufregendere Romane, denn das, was in Hill House umtriebig ist, ist zunächst nicht viel mehr als ein schauriges Tischfeuerwerk, das eher Unbehagen als Entsetzen auslöst. Wirkliches Entsetzen verursacht der Roman erst, wenn man ihn durchgelesen hat und einem einiges klar wird.
Die Handlung ist schnell erzählt: Ein possierlich knuddelig-bärtiger Dr. Montague möchte gern die übersinnliche Energie, die man allgemeinhin Hill House nachsagt, wissenschaftlich belegen. Zu diesem Zweck mietet er sich für eine begrenzte Zeit in Hill House ein und stellt drei Mitarbeiter an, die er für besonders geeignet hält, die Aufgabe anzugehen, als da wären: der Nichtsnutz, „Lügner“ und „Dieb“ Luke Sanderson, der Hill House irgendwann erben wird, sowie die beiden Frauen Eleanor Vance und Theodora. In der Folge erleben die Protagonisten allerlei Merkwürdigkeiten, die man im klassisch-schauerromantischen Sinne als „Kettengerassel“ titulieren könnte. Zunehmend wird die Haut der vier Hobbyforscher, insbesondere die der beiden Frauen, aber dünner, und mehr und mehr rückt Eleanor in den Fokus, die offenbar eine besondere Verbindung zu Hill House zu haben scheint.
Und damit wären wir dann doch bei der psychologischen Ebene des Romans angelangt.
Shirley Jacksons Psychologie ist unmittelbar an Hill House gekoppelt. In Hill House geht nicht etwa ein rächender Geist um. Vielmehr ist Hill House gemäß des vielzitierten ersten Satzes des Romans ein eigenständiger Organismus. Auch ist Hill House für die psychisch halbwegs gesunden Charaktere zu keinem Zeitpunkt eine wirkliche Gefahr, anders als für Eleanor, mental stark beschädigt, traumatisiert von einem gesellschaftsfernen Leben unter der Fuchtel ihrer herrischen Mutter. Der Tod der Mutter nach elf Jahren aufopfernder Krankenpflege bis hin zum Ende hat Eleanor tiefsitzende Schuldgefühle eingeimpft. Diese sensible, endlos verletzte Frau, die in ihrem Erwachsenenleben „niemals glücklich“ war, und das düstere, polymorphe Haus bilden alles andere als eine erfolgsversprechende Fusion, wobei schwer zu sagen ist, wann das Haus Eleanor manipuliert und wann Eleanor selbst das Haus als Katalysator für ihre eigene ungesunde Erlebniswelt benutzt.
Während für die drei anderen Beteiligten Hill House eher gruselige Unterhaltung ist, ist der Aufenthalt in Hill House für Eleanor existentiell. Mehrmals lässt sie durchblicken, wie glücklich sie in Hill House ist. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie ihr graues, unterdrücktes Leben verlassen und fühlt sich als Teil einer ihr wohlgesinnten Gruppe.
Der Fokus dieses Glücklichseins ist maßgeblich in ihrer Beziehung zu Theodora zu finden, die bei genauem Hinschauen romantische Züge trägt.
Bereits schon in Jacksons früherem Roman Hangsaman [Der Gehängte] haben Kritiker lesbische Untertöne entdeckt. Shirley Jackson selbst aber, die auch in ihrem realen Leben wegen sehr enger Beziehungen zu Frauen in diesem Verdacht geriet, wehrte es in der Öffentlichkeit vehement ab, was, der damaligen Zeit (ca. Mitte des 20. Jahrhunderts) geschuldet, nur zu verständlich ist.
Wenn man sich The Haunting of Hill House darauf bezogen einmal genau anschaut, spricht tatsächlich einiges für die Vermutung, dass Theodora lesbisch ist. Ich habe mehr als dreißig Textstellen ausfindig gemacht, in denen Theodora Nell bzw. Nellie (wie sie Eleanor zärtlich nennt) körperlich berührt, herzt, drückt, umarmt und umgarnt. „Theodora drängte sich eng an sie“, heißt es an einer Stelle. Mehrmals ergreift Theo innig Nells Hand.
Je enger Theo und Nell zusammenrücken, umso mehr legt Hill House an Fahrt auf. Von Jackson meisterhaft in Szene gesetzt, zeigt Hill House zunehmend sein düsteres Gesicht. Jackson baut eine stickige, einengende Atmosphäre des Bedrohlichen auf, liefert immer mehr kleine Details, die die Luft kälter werden lassen. Ihre einschüchternde imaginäre Architektur von Hill House gehört zu den subtilsten und suggestivsten Schilderungen ihrer Art.
Auch Nell ist Theo, wie sie Theodora nennt, sehr zugetan. „[… W] hübsch sie ist […]“, denkt sie bei Theos Anblick. Theo ist für Nell eine Spiegelung ihrer selbst, wie sie gern wäre: Theo ist das genaue Gegenteil von Nell, vorlaut, in den Tag lebend, immer positiv denkend. Dass es hier um mehr geht als um eine Freundschaft, wird an einigen Stellen deutlich. Die Szene, in der Theo Nell die Fußnägel lackiert, atmet ein spürbar erotisches Fluidum. Zu einem femininen, völlig abgeschlossenen und den Männern des Buches verwehrten Raum mit jetzt deutlicherer sexueller Symbolik erwächst das gemeinsame Badezimmer, in dem Theo Nell bittet, ihr Badewasser weiter zu nutzen. Indem Nell dies tut, vollendet sie den Akt. Die gemeinsame Verwendung des Badewassers repräsentiert hier einen Moment absoluter Intimität, wie sie nur der Geschlechtsakt bietet.
Diese Szene ist ein treffendes Beispiel dafür, wie subtil Shirley Jackson das sagt, was sie letztlich wirklich sagen will. Während Nell badet, hält Theo sie zur Eile an, weil das gemeinsam mit den beiden Männern stattfindende Frühstück ansteht. „Du musst doch inzwischen sauber genug sein, dass wir zum Frühstück gehen können“, treibt Theo Nell weiter an. Warum aber muss Nell für das Frühstück mit den beiden Männern besonders sauber sein? Damit sie nichts von der Sexualität der beiden Frauen bemerken! Wir wollen bedenken, dass wir uns in den 1950er-Jahren bewegen. Mit nur einem Satz feuert Jackson gegen die Repressalien des Patriarchats und eröffnet damit spielerisch innerhalb einer metaphorischen Ebene eine weitere Sub-Ebene des Romans. Das ist es, was ich meinte, nur ein Beispiel von vielen, die man hinter Jacksons trügerisch klarer, realistischer Sprache aufspüren kann. Der Roman ist durch geschicktesten Einsatz des Werkzeugs Sprache gespickt mit derartigen Rätseln.
Zuweilen hängt es einfach vom Fachwissen und Erfahrungshorizont der Leserschaft ab (Psychologie, amerikanisches Vokabular der 1950er Jahre, Shirley Jacksons eigenes gleichzeitig repressive und exzessive Leben etc.), wie tief man letztlich in Hill House eindringt.
Umso problematischer gestaltet es sich natürlich für die Leser einer Übersetzung. So macht es einem beispielsweise die deutsche (grundsätzlich gute) Übersetzung zusätzlich schwer, sich der lesbischen Symbolhaftigkeit sicher zu sein zu können, indem bezogen auf Theodoras Partnerschaft in ihrem Leben vor Hill House „friend“ mit „Freund“ übertragen wird. Indem er gar nicht erst auf die Idee kommt, dass es auch „Freundin“ lauten könnte, tappt Übersetzer Wolfgang Krege genau in die patriarchale Falle, die Shirley Jackson anprangert.
An dieser Stelle möchte ich aber dringend darauf hinweisen, dass dies alles Details sind, die man suchen kann aber nicht muss, denn die Genialität Jacksons liegt auch darin, dass sie schlichtweg einen virtuosen und gut lesbaren Roman geschrieben hat, dessen weibliche Hauptfigur Eleanor unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme weckt.
Die Zuneigung und die Zuwendungen, die Nell von Theo erhält, sowie die Akzeptanz, die ihr von Dr. Montague und Luke entgegengebracht wird, sind ein Lichtblick in Eleanors angekettetem Leben. Zum ersten Mal fühlt sie sich als Teil einer Gemeinschaft. Kein Wunder, dass sie glaubt, dass Hill House gut für sie ist. Doch die Stimmung kippt genau in dem Moment, in dem sie Theo gegenüber einen richtungsweisenden Vorstoß unternimmt. Als wolle Hill House sie mit allen Mitteln bei sich behalten und keinesfalls an Theo abgeben, lenkt das Haus das Geschehen frontal in die Tragödie, von der die arme Eleanor nicht weiß, dass sie selbst der maßgebliche Teil davon ist.
Deutsche Übersetzung: Spuk in Hill House, übersetzt von Wolfgang Krege (Zürich: Diogenes, 1993)
Gefällt mir Wird geladen …